Rudolf Pfleiderer
März 2008
Kritik an der großräumigen Verkehrsuntersuchung zur Planung der Bundesstraße 26n von Juli 2007

1. Einleitung
Die DR. BRENNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH hat im Auftrag des staatlichen Bauamts Würzburg eine großräumige Verkehrsuntersuchung (VU) zur Planung der Bundesstraße 26 neu (B 26n) erarbeitet. Diese VU hat grundsätzliche Mängel wie sie bei derartigen Verkehrsuntersuchungen häufig vorkommen.
Die geplante B 26n ist 46 km lang (Quelle: BVWP-Dossier, BVWP = Bundesverkehrswegeplan) und verbindet die A3 im Westen von Würzburg mit der A7 im Norden von Würzburg und stellt damit Teil eines großräumigen Fernstraßenrings um Würzburg dar (obere der beiden rot gestrichelt dargestellten Trassen). Die Trassierungselemente liegen noch nicht fest. Aus der VU geht hervor, dass voraussichtlich ein dreistreifiger Querschnitt oder ein vierstreifiger Querschnitt ohne Standstreifen (Kraftfahrstraße) gewählt wird. Im BVWP ist die B 26n mit vierstreifigem Querschnitt plus Standstreifen, also als Autobahn, enthalten.
Diese Kritik geht vorwiegend auf die Mängel der vorliegenden VU ein, wie sie auch bei anderen derartigen Verkehrsuntersuchungen üblich sind. Auf die verschiedenen Varianten des Projekts wird nicht eingegangen. Die Kritik beschränkt sich auf den Planfall 2, der dem BVWP-Fall entspricht.
2. Zusammenfassung, Schlussfolgerungen
Derartige Verkehrsuntersuchungen dienen dazu, einen Straßenbau zu rechtfertigen, für den es in der heutigen Zeit keine Rechtfertigung geben dürfte. Die – neben dem Eingriff in die Landschaft – wichtigste verkehrliche Wirkung des Straßenbaus, der induzierte Verkehr, wird bei den Berechnungen nicht berücksichtigt. Deswegen ist die vorliegende VU falsch. Die VU muss zurück gewiesen werden und es muss gefordert werden, dass die Belastungszahlen mit Berücksichtigung des induzierten Verkehrs neu gerechnet werden, sofern das Projekt nicht ganz aufgegeben wird.
Der Bau von Straßen wie der B 26n macht das Autofahren attraktiver. Deswegen wird mehr gefahren. Treibstoffverbrauch und Emissionen nehmen zu. Der Straßenbau in der BRD (alle Straßen, nicht nur Bundesfernstraßen) induziert eine Verkehrszunahme von jährlich ungefähr 1 Prozent. Das heißt, der Straßenbau ist die wichtigste Determinante des Verkehrswachstums.
Es wird geschätzt, dass die Verkehrszunahme durch den Bau der B26n in der Größenordnung von 600.000 Fahrzeug-Kilometern je Tag liegt. Entsprechend nehmen Treibstoffverbrauch und Emissionen zu.
Die Entlastungen, die den betroffenen Bürgern versprochen werden, sind geringer als in der VU berechnet wurde. Deswegen ist die VU ungeeignet zur Beurteilung des Projekts. Öffentlichkeit und Mandatsträger werden getäuscht.
Angesichts des sich abzeichnenden Klimawandels und der Tatsache, dass wir uns zur Zeit (in diesem Jahrzehnt) auf dem Höhepunkt der Erdölförderung befinden, muss offensichtlich alles unterlassen werden, was zu höherem Energieverbrauch führt. Dazu gehört der Straßenbau.
Anzustreben ist also eine Verringerung des Autoverkehrs. Dies kann dadurch erreicht werden, dass der Verkehr entschleunigt wird, und zwar auf allen Straßen. Wirkungsvoll sind Maßnahmen, die dort ansetzen, wo viele Autos schnell fahren. Viele Ortsdurchfahrten sind Fehlkonstruktionen. Das Potenzial zur Dämpfung der Geschwindigkeiten ist groß.
Darüber hinaus ist die finanzielle und personelle Position der Straßenbauverwaltung zu hinterfragen, die in unserem politischen System eine Machtfunktion hat, die ihr nicht zukommen sollte. Ein Beispiel dafür ist die vorliegende VU. Die Straßenbauverwaltung kann es sich erlauben, unter Ausnutzung ihres Informationsvorsprungs Behauptungen über angebliche Entlastungswirkungen des Straßenbaus in die Welt zu setzen, die ein Laie nicht ohne weiteres überprüfen kann.
Bisher sind die Straßenbauverwaltungen offenbar der Meinung, die Landschaft wäre zu nichts anderem da als zum Straßenbau. Schwerpunkt der Arbeit der Straßenbauverwaltungen sollte in Zukunft der Erhalt und die Verbesserung des Bestands (zum Beispiel Lärmschutz) sein sowie der geordnete Rückbau falsch konstruierter Straßen.
3. Verwendete Unterlagen
Die VU besteht aus 71 Dateien. Herangezogen für diese Kritik wurden im Wesentlichen:
| pdf-Datei | |
| abb03 | auf Seite 1 dieser Kritik ausgedruckt |
| 2823-EB-V4 | Das ist der Text der Untersuchung, die hier als VU bezeichnet wird. |
| Plan01 | Status Quo 2006: Modellierte Verkehrsbelastung & Zählwerte |
| Plan02 | Status Quo 2006: Streckenqualität (erzielbare Reisegeschwindigkeiten) |
| Plan03 | Prognosebezugsfall 2020 |
| Plan09 | Planfall 2 (PF 2) Verkehrsbelastung |
| Plan10 | Planfall 2 (PF 2) Diff. zum Bezugsfall (Differenz zwischen Plan09 und Plan03) |
Außerdem stand das BVWP-Dossier der B 26 zur Verfügung.
Diese Dossiers sind die Zusammenfassungen der gesamtwirtschaftlichen Bewertungen, die für alle Projekte des BVWP (Bundesverkehrswegeplans) durchgeführt werden.
4. Bemerkungen zur Qualität der VU
Abgesehen von den oben erwähnten grundsätzlichen Mängeln, die die VU unbrauchbar zur Beurteilung des Auswirkungen des geplanten Projekts machen, ist die VU auf hohem Niveau.
Die Modellierung großer Verkehrsnetze, also die Darstellung der Wirklichkeit auf dem Computer, war beim BVWP 1992 noch unbrauchbar. Abweichungen um den Faktor 2 zwischen den Angaben im BVWP und der Wirklichkeit waren normal.
Der Plan01 deutet darauf hin, dass die Modellierung bei der vorliegenden VU wahrscheinlich eine brauchbare Genauigkeit erreicht hat. In dem Plan sind die gezählten Werte und die modellierten Werte, also die Werte im Computer, verglichen. Im Plan09 ist die Belastung mit 37200 Kfz/d bis 41300 Kfz/d angegeben. Im BVWP-Dossier ist die Belastung mit circa 36000 Kfz/h angegeben. Diese Übereinstimmung ist gut.
Interessant ist der informative Plan02 mit den Reisegeschwindigkeiten für den Status Quo. Es wäre noch schöner gewesen, wenn auch entsprechende Darstellungen für den Prognosebezugsfall und die Planfälle vorgelegt worden wären. Die dafür erforderlichen Daten müssten im Rahmen der Berechnungen verfügbar gewesen sein.
Das Berechnungsverfahren ist scheinbar ausführlich beschrieben. In Wirklichkeit kann man mit diesen Informationen nichts anfangen. Sie dienen dem Zweck, den Eindruck eines hohen wissenschaftlichen Niveaus zu erwecken. Tatsächlich ist das Berechnungsverfahren nicht naturwissenschaftlich.
5. Verkehrsentwicklung (zeitliche Prognose), induzierter Verkehr
Zur allgemeinen Verkehrsentwicklung finden sich in der VU auf Seite 34 Angaben. Danach ist zwischen 2006 und 2020 mit einer Zunahme des Verkehrs von durchschnittlich 5,3 % zu rechnen. Auf Seite 18 ist die allgemeine Verkehrszunahme mit 7,5 % angegeben. Pro Jahr wäre das ein Anstieg von 0,3 % bzw. 0,5 %.
Wie die Entwicklung in den nächsten Jahren verlaufen wird, kann nur ungenau angegeben werden. Denn es ist nicht einmal die tatsächlich statt gefundene Verkehrsentwicklung mit brauchbarer Genauigkeit bekannt. Das DIW veröffentlicht einmal im Jahr die Zahlen der Verkehrsentwicklung („Verkehr in Zahlen“). Im Jahr 2003 revidierte das DIW seine Zahlen um 14 % nach oben, wobei keineswegs sicher ist, dass die revidierten Zahlen der Wirklichkeit wesentlich näher kommen als die alten Zahlen. Das heißt, es ist nicht einmal bekannt, ob der Verkehr in der Zeit seit 1999 gestiegen oder gefallen ist. Siehe das Diagramm.
Da man es nicht besser weiß, wird hier angenommen, dass der Verkehr in den nächsten Jahren um ungefähr 0,5 % pro Jahr zunehmen wird. Diese Verkehrszunahme wird laut der VU bestimmt durch die Bevölkerungsentwicklung (Demografie), die Arbeitsplatzentwicklung, die zunehmenden Zahl der Autos und die abnehmenden Kilometerleistung pro Auto.
Die wichtigste Bestimmungsgröße für die Verkehrsentwicklung, nämlich der Straßenbau, wird hier nicht erwähnt. Wie im folgenden Abschnitt erläutert wird, führt Straßenbau dazu, dass der Straßenverkehr zunimmt. Dieser wichtige, offenkundige Tatbestand wird in der VU verschwiegen, weil es sonst schwerer wäre, eine Straße wie die B 26n zu rechtfertigen.
Im acatech-Bericht >Mobilität 2020. Perspektiven für den Verkehr von Morgen< (http://www.acatech.de) finden sich eindeutige Aussagen zu dem Thema. Auf Seite 23 des acatech-Berichts steht zum Beispiel korrekt, dass ein wesentlicher Grund für die Zunahme der MIV-Fahrleistungen das erweiterte Autobahnnetz ist, das länger Fahrten in kürzerer Zeit ermöglicht. Die Verfasser des acatech-Berichts wussten offenbar – im Gegensatz zur DR. BRENNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH – dass neue Straßen Verkehr induzieren. An anderer Stelle im acatech-Bericht (Seite 25) steht: „Durch die neuen Verbindungen ... ist es möglich, in der gleichen Zeit weiter zu fahren. Dementsprechend steigt der Anteil der längeren Wege.“ So ist es.
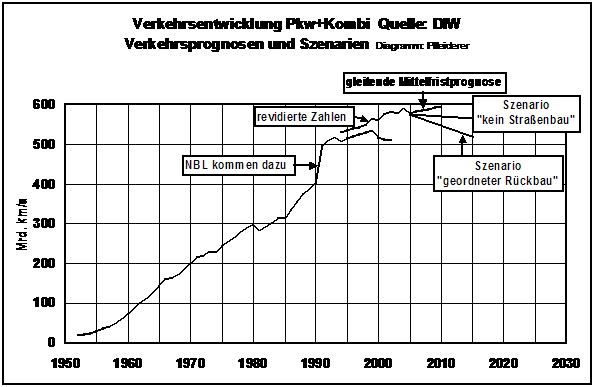
Auf Seite 26 des acatech-Berichts ist angegeben, dass die Fahrtenlängen pro Fahrt zwischen 2002 und 2020 als Folge des Straßenbaus durchschnittlich um fast 10 % zunehmen. Das entspricht einer Verkehrszunahme von ungefähr 0,5 % pro Jahr. Der acatech-Bericht berücksichtigt wie der BVWP nur die Bundesfernstraßen (Autobahnen und Bundesstraßen). Da auch Landesstraßen (in Bayern Staatstraßen genannt) sowie Kreisstraßen und Gemeindestraßen gebaut werden, liegt man mit einer Schätzung eines durch Straßenbau induzierten Verkehrswachstums von 1 % pro Jahr auf der sicheren Seite.
Das heißt, ohne Straßenbau würde der Verkehr nicht um 0,5 % pro Jahr zunehmen, sondern um 0,5 % pro Jahr abnehmen. Siehe das Diagramm, Szenario „kein Straßenbau“.
Durch „milde“ Maßnahmen wie ein Tempolimit auf Autobahnen und ein Tempolimit auf einbahnigen Außerortsstraßen sowie einen „geordneten Rückbau“ des Straßennetzes (siehe Kapitel 9) könnte ein Verkehrsrückgang von ungefähr 1,5 % pro Jahr erreicht werden.
6. Wie induzieren neue Straßen neuen Verkehr ?
Wenn sich durch Straßenbau oder andere Ursachen die Durchschnittsgeschwindigkeit auf einer Quelle-Ziel-Beziehung vergrößert, so führt dies für die Verkehrsteilnehmer, die diese Beziehung befahren, zu Zeiteinsparungen. Diese eingesparten Zeiten werden (bei langfristiger Betrachtung) in den Verkehr reinvestiert. Der so entstehende Mehrverkehr ist der induzierte Verkehr. Besser wäre der Fachbegriff ‚Neuverkehr’. In der politischen Diskussion hat sich jedoch der Begriff ‚induzierter Verkehr’ durchgesetzt.
Siehe auch die Zitate aus dem acatech-Bericht im Kapitel 5.
Der induzierte Verkehr darf nicht verwechselt werden mit verlagertem Verkehr (von anderen Straßen oder von anderen Verkehrsträgern). Auch Mehrverkehr, der dadurch entsteht, dass zum Beispiel Verkehr von einer Ortsdurchfahrt auf eine längere Ortsumgehung verlagert wird, ist nicht induzierter Verkehr. Durch den Bau der B 26n würden sich für bestimmte Verkehrsbeziehungen Abkürzungen ergeben. Dadurch verringert sich die Fahrleistung. Dies ist nicht negativer induzierter Verkehr.
Im BVWP wird der Eindruck erweckt, der induzierte Verkehr wäre berücksichtigt. Tatsächlich werden nur ungefähr 7,7 % des induzierten Verkehrs berücksichtigt. In Verkehrsgutachten wird häufig um den heißen Brei herum geredet, und es werden mehr oder weniger zutreffende Aussagen zum induzierten Verkehr gemacht ohne ihn bei den Berechnungen zu berücksichtigen. Bei der vorliegenden VU hat es sich die DR. BRENNER INGENIEUR-GESELLSCHAFT MBH leicht gemacht und tut so, als ob es den induzierten Verkehr überhaupt nicht gäbe. In diesem Punkt muss die VU als besonders rückständig bezeichnet werden.
Bei der Berechnung der Wirkungen der B 26n hätte für den Prognosebezugsfall und für den Planfall eine andere Matrix verwendet werden müssen. Bei der Planfall-Matrix muss mit höherem Verkehrsaufkommen gerechnet werden. Dass mit derselben Matrix gerechnet wird, zeigt, dass die VU fundamental falsch ist.
Die Definition des induzierten Verkehrs (oben) gilt für den Personenverkehr. Beim Güterverkehr wird nur ein Teil der durch Straßenbau gewonnenen Zeit in den Verkehr reinvestiert. Die Verkehrswissenschaft hat bisher nicht erforscht, wie groß dieser Anteil ist.
7. Abschätzung des durch die B 26n induzierten Verkehrs
Beim vorliegenden Projekt lässt sich der induzierte Verkehr mit grober Näherung leicht abschätzen, denn im BVWP-Dossier sind die eingesparten Zeiten angegeben. Diese eingesparten Zeiten bilden den wesentlichen angeblichen volkswirtschaftliche Nutzen eines Straßenprojekts. Die eingesparten Zeiten werden mit einem Zeitkostensatz multipliziert, der vom Verkehrszweck abhängt. Freizeitverkehr wird niedriger bewertet als Geschäftsverkehr. Dass die eingesparten Zeiten gar nicht für andere Nutzungen zur Verfügung stehen, weil sie in den Verkehr reinvestiert werden, wird im Rahmen des BVWP nicht zur Kenntnis genommen.
Im BVWP-Dossier ist angegeben, dass der Bau der B 26n zu Zeiteinsparungen von 5,841 Mio. Kfzh/a führt, wobei hier einfachheitshalber nur der Pkw-Verkehr betrachtet wird. Die im Dossier angegeben Zeiten sind allerdings schöngerechnet und in Wirklichkeit niedriger. Es wird nämlich nicht berücksichtigt, dass durch den induzierten Verkehr das Verkehrsaufkommen steigt und daher in Wirklichkeit die Geschwindigkeitsgewinne geringer sind. Daher wird der angegebene Wert ungefähr halbiert und es wird von 3 Mio. Kfzh/a eingesparte und wieder reinvestierte Zeit ausgegangen. Das sind ganz grob 10.000 Kfzh/d.
Mit welchen Geschwindigkeiten diese Zeiten in den Verkehr reinvestiert werden, ist nicht bekannt. Aber es geht ja nur um die Größenordnung. Es wird hier eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 60 km/h angenommen. Daraus ergibt sich eine Fahrleistung des induzierten Verkehrs von 600.000 Fzkm/d und bei Annahme eines Treibstoffverbrauchs von 10 Liter je 100 km ein Treibstoffmehrverbrauch von 60.000 Liter pro Tag.
Mandatsträger und Öffentlichkeit müssen darüber informiert werden, dass der Bau von Straßen wie der B 26n zu mehr Treibstoffverbrauch und damit auch zu mehr Emissionen führt und daher im Gegensatz zu dem Ziel steht, die CO2-Emissionen zu verringern.
Es ist nur sehr grob möglich, abzuschätzen, wo der in der VU nicht berücksichtigte induzierte Verkehr statt findet. Auf jeden Fall kommen die Fahrzeuge, die die B 26n nutzen, in den Genuss von Geschwindigkeitsgewinnen. Außerdem erhöht sich die Geschwindigkeit auf dem parallel verlaufenden Abschnitten der A7 und A3 sowie auf den anderen, „kleineren“, parallel verlaufenden Straßen. Wenn man davon ausgeht, dass sich die Hälfte des induzierten Verkehrs auf ein Straßennetz von ungefähr 200 km Länge im Untersuchungsgebiet verteilt, während die andere Hälfte dazu führt, dass der Verkehr auf den Zu- und Ablaufstrecken zunimmt, so ergibt sich gegenüber der Berechnung in der VU eine durchschnittliche Zunahme des Verkehrsaufkommens von 600 000 Fzkm/d / 200 km = 3000 Kfz/d. Dieser Wert gibt nur ganz grob die Größenordnung des Fehlers der in der VU angegebenen Belastungen an.
8. Die B 26n wird nicht wegen der Entlastung von Ortsdurchfahrten gebaut
Die B 26n wird geplant, um das Fernstraßennetz zu erweitern und damit mehr Verkehr zu erzeugen, der dann wiederum zur Rechtfertigung des Baus weiterer Straßen dienen kann.
Dieser Tatbestand wird in der VU vernebelt, in dem behauptet wird, es sei das Ziel, Ortsdurchfahrten zu entlasten. In der VU ist zum Beispiel auf den Seiten 44 ff von der Entlastung folgender Straßen die Rede:
- B8 Waldbüttelbronn
- St2298 Hettstadt
- B26 Arnstein - Thüngen
- MSP 1 Schebenried - Karlstadt
- B27 Hammelburg - Karlstadt
- B19 zwischen AS Werneck und Greinbergknoten Würzburg
- In Würzburg Rückverlagerung des Verkehrs von den Stadtstraßen auf die B 19 mit der Folge von großflächigen Verkehrsabnahmen im nachgeordneten Straßennetz von Würzburg
- Ortsdurchfahrten Greußenheim, Rimpar, Leinach, Birkenfeld
- St2315 zwischen Marktheidenfeld und Lohr und entlang der B 26 bis Gemünden.
Wie im Abschnitt 7 erklärt und ganz überschlägig berechnet wurde, sind diese Entlastungen deutlich geringer als in der VU angegeben. Außerdem entstehen zusätzliche Belastungen an anderer Stelle, die in der VU nicht dargestellt sind.
Aber selbst wenn man die Zahlen aus der VU als bare Münze nehmen würde, wären die Entlastungen nicht besonders groß (außer B19). So sagt Kreisrat Wolfgang Rupp (PM des KV Main-Spessart der Grünen vom 23.11.2007): „Es kann nicht sein, dass man eine Verschiebung des Autoverkehrs für 380 Mio. Euro finanziert“. Wäre Wolfgang Rupp über die Auswirkungen des Baus der B 26n korrekt informiert worden, hätte er vielleicht gesagt:
| „Es kann nicht sein, dass man angesichts der drohenden Klimaänderung und der sich abzeichnenden Ölpreissteigerung den zusätzlichen Verbrauch von einigen zig Tausend Litern Treibstoff pro Tag für 380 Mio. Euro finanziert.“ |
Straßenplaner machen „Denkfehler“:
Straßenplaner argumentieren stets, man müsse dem Autoverkehr schnelle Verbindungen zur Verfügung stellen, damit andere Teile des Straßennetzes entlastet werden.
Straßenplaner argumentieren nie, man müsse den Autoverkehr dort, wo man ihn nicht haben will, langsamer machen, damit er woanders fährt.
Es wird ignoriert, dass es wesentlich einfacher ist, den Verkehr auf einer Straße langsamer zu machen als durch eine neue Straßen den Verkehr irgendwo schneller zu machen und zweitens wird ignoriert, dass durch Beschleunigung der Verkehr per Saldo mehr wird (induzierter Verkehr), während der Verkehr durch Entschleunigung weniger wird.
Straßenplaner behaupten, bei niedrigen Geschwindigkeiten wären der Treibstoffverbrauch und die Emissionen sehr hoch und begründen damit einen Straßenbau für hohe Geschwindigkeiten. Dabei stützen sie sich auf das Diagramm nach Bild 1. In der Tat steigt bei niedrigen Geschwindigkeiten der auf die Strecke bezogene Treibstoffverbrauch stark an. Es ist aber falsch, auf die Strecke zu beziehen. Niemand fährt 100 km mit einer Geschwindigkeit von nur 10 km/h. Da die im Verkehr zugebrachte Zeit konstant ist, muss man auf die Zeit beziehen. Nach Bild 2 ist der Treibstoffverbrauch bei niedrigen Geschwindigkeiten am niedrigsten.
Der Verlauf in Bild 2 ergibt sich aus dem Verlauf in Bild 1 durch Multiplikation mit der Geschwindigkeit V.
| kg/100 km | 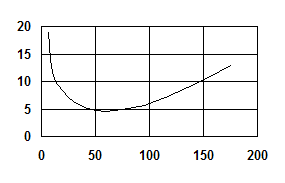 |
| km/h |
Bild 1: Streckenspezifischer Treibstoffverbrauch eines typischen Pkw in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit
| kg/h |  |
| km/h |
Bild 2: Zeitspezifischer Treibstoffverbrauch eines typischen Pkw in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit
Die Berechnungen der angeblichen Entlastungen der B 19 müssen als besonders abenteuerlich bezeichnet werden. Dies ist ohne verkehrswissenschaftlichen Sachverstand zu erkennen.
Beispielsweise wird für die B19 nördlich Eßleben eine Verringerung des Verkehrsaufkommens um 5600 Kfz/d und damit fast eine Halbierung des Verkehrs von 12500 auf 6900 Kfz/d versprochen (Plan03, Plan09, Plan10, Seite 45) obwohl die B 26n gar nicht unmittelbar parallel sondern in großer Entfernung verläuft. Es wird offenbar angenommen, dass die parallel zur B 19 verlaufende A 7 so stark belastet ist, dass die B 19 trotz mehrerer Ortsdurchfahrten die schnellere Alternative zwischen der AS der A70 Werneck und der AS der A7 Würzburg-Estenfeld ist. Durch die B26n würde die A7 entlastet und damit schneller und dadurch würde sich der Verkehr von der B19 auf die A7 verlagern.
Es ist jedoch kaum vorstellbar, dass die B19 derart viel (5600 Kfz/d) Durchgangsverkehr hat. Und falls dies wirklich so wäre, so könnte dieser Verkehr ganz einfach auf die A 7 verlagert werden, in dem der Widerstand der B19 erhöht wird. Das heißt, man muss das Tempo auf der B19 verringern und damit die Fahrtzeit auf der B19 vergrößern.
9. Entschleunigung, Straßenrückbau statt Straßenneubau
Wenn man will, dass irgendwo der Verkehr weniger wird, dann muss man sich dafür einsetzen, dass der Verkehr dort und auf den Zu- und Ablaufstrecken entschleunigt wird. Wenn man das überall macht, wird der Verkehr insgesamt weniger.
Falls es zum Beispiel als erstrebenswert angesehen wird, dass der Verkehr auf städtischen Straßen in Würzburg großflächig verringert wird wie dies auf Seite 45 steht, dann muss dafür gesorgt werden, dass das ganze Straßennetz langsamer wird. Wie das zu machen ist, steht in den FGSV-Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen, Ausgabe 2006 (RASt 06). Die RASt 06 gelten für alle Innerortsstraßen sowie die „Vorfeldstraßen“. Das sind Straßen auf denen typisch Tempo 70 angeordnet ist. Das heißt, die RASt 06 decken weit über die Hälfte aller Straßen ab. Würden die RASt 06 flächendeckend angewendet, würde es in unseren Städten und Dörfern ganz anders, nämlich menschengerechter und weniger autogerecht aussehen.
Fast die gesamte B19 zwischen Würzburg-Heidingsfeld und Unterpleichfeld muss als Fehlkonstruktion bezeichnet werden. Die vierstreifige, teilweise sogar fünfstreifige, weitgehend kreuzungsfrei in der Nähe von Wohngebieten geführte B19 in Würzburg ist ein Beispiel von Stadtzerstörung durch den Straßenbau. Auch außerorts, zwischen Würzburg und der A7, ist die B19 offensichtlich überdimensioniert. Zwischen der A7 und Unterpleichfeld ist die B19 8,50 m breit. Dieses früher weit verbreitete Maß für die Breite von Landstraßen ist aus gutem Grund in dem einschlägigen Regelwerk (RAS-Q 96) nicht mehr enthalten. Man hat erkannt, dass Straßen mit schmäleren Querschnitten weniger gefährlich sind. (Bedauerlicherweise enthält die VU keinerlei Aussagen zur Verkehrssicherheit).
Eine typisches Beispiel ist die Ortsdurchfahrt von Opferbaum. Die B19 ist hier 7,30 m breit, während für die Gehwege nur noch ungefähr 90 Zentimeter verblieben sind. Laut RASt 06 würde zur Begegnung von Lkw und Bussen mit 50 km/h eine 6,35 m breite Fahrgasse ausreichen. Wird für diesen Begegnungsfall Tempo 30 als ausreichend erachtet, so genügen 5,90 m.
In der Ortsdurchfahrt von Eßleben ist die B19 sogar 8 Meter breit.
Neben einer Verschmälerung der Fahrbahn bei gleichzeitiger Verbreiterung der Gehwege bieten die RASt 06 ein reichhaltiges Instrumentarium zur Geschwindigkeitsdämpfung in derartigen Ortsdurchfahrten bei gleichzeitiger Verbesserung der Situation für Fußgänger. Dazu gehören nicht nur Zebrastreifen sondern auch Überquerungshilfen wie zum Beispiel Hüpfinseln sowie Teilaufpflasterungen, die allerdings richtig dimensioniert werden müssen, damit sich einerseits das gewünschte Geschwindigkeitsniveau einstellt und andererseits kein zusätzlicher Lärm entsteht.

Fehlkonstruktion: Ortsdurchfahrt von Opferbaum im Zuge der B19
Ehe neue Straßen wie die B26n geplant und gebaut werden, sollten die Straßenbauverwaltungen dafür sorgen, dass die in der Vergangenheit falsch konstruierten Straßen in Ordnung gebracht werden.
Der Lkw-Verkehr kann dadurch verringert werden, dass die bestehenden Tempolimits, Sicherheits- und Sozialvorschriften konsequenter überwacht werden. Jede Gemeinde, die unter dem Lkw-Verkehr leidet, kann sich dafür einsetzen, dass mehr Fahrzeugkontrollen auf ihrer Gemarkung durchgeführt werden.
